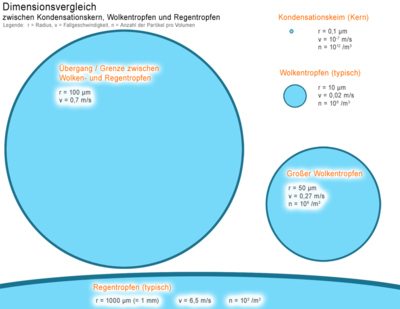13. Juli 2014 | Dipl.-Met. Lars Kirchhübel
Regen - Lebenswichtiges Elixier mit zerstörerischer Kraft
Es regnet seit geraumer Zeit. Mal schauerartig verstärkt und gewittrig, mal länger anhaltend. Das Wasserdefizit aus dem Frühjahr ist in vielen Regionen des Landes mittlerweile schon fast wieder ausgeglichen. Doch wie entsteht überhaupt der Regen?
Bei der Entstehung von Regentropfen spielen viele, mehr oder weniger,
komplexe Prozesse eine Rolle. Im ersten Schritt zum flüssigen
Niederschlag betrachten wir die Bildung von Wolkentropfen. Der
verantwortliche physikalische Prozess ist die sogenannte
"Kondensation".
Kondensation ist dabei das Gegenteil vom Verdampfen. Hierbei wird ein
gasförmiger Stoff (Wasserdampf) zu einem flüssigen (Wasser). Ob etwas
verdampft oder kondensiert, hängt von der Temperatur ab. Ein
flüssiger Stoff (Wasser) verdampft, wenn die Temperatur auf einen
bestimmten Wert ansteigt. Und ein gasförmiger Stoff (Wasserdampf)
kondensiert, wenn die Temperatur sinkt. Der Grund für die Verdunstung
von Wasser und die Kondensation des Wasserdampfes ist der, dass Luft
nicht immer gleich viel Wasser speichern kann. Je wärmer die Luft
ist, desto mehr Wasserdampf - also gasförmiges Wasser - kann sie
aufnehmen. Gleichzeitig steigt die Luftfeuchtigkeit. Sinkt die
Temperatur der Luft jedoch, kann sie nicht mehr so viel Feuchtigkeit
speichern. Erreicht die Luftfeuchtigkeit dann 100%, so fällt der
Wasserdampf durch den Prozess der Kondensation als sogenannte
Wolkentropfen, aus.
Die Kondensation tritt auf, wenn die Luft infolge von Hebung
(Aufsteigen) abkühlt. Dafür gibt es in der Natur verschiedene Gründe.
Strömt zum Beispiel die Luft gegen ein Gebirge, so wird sie gezwungen
aufzusteigen, um das Hindernis zu überwinden (Orographische Hebung).
Auch wenn die Sonne den Boden und somit auch die bodennahen
Luftschichten sehr stark aufheizt, stellt sich "Hebung" ein, da die
schwerere, kältere Luft in der Höhe absinkt und die leichtere,
wärmere Luft gleichzeitig aufsteigen möchte (Konvektion). Auch im
Bereich von Tiefausläufern, wo sich entweder kältere Luft unter die
wärmere Luft schiebt (Kaltfront) oder die wärmere Luft auf die
bodennahe kalte Luft aufgleitet (Warmfront), wird Luft gehoben. Da es
mit der Höhe immer kälter wird, kühlt sich die mit Wasserdampf
angereicherte Luft beim Aufsteigen ab.
Durch Kondensation können die Wolkentropfen jedoch höchstens die
Größe von Nieseltröpfchen erreichen. Für die Auslösung von
Niederschlag (Regen) muss also ein weiterer wirksamer Prozess geben,
bei dem die Nieseltröpfchen anwachsen können.
Gegenwärtig gibt es zwei Theorien für die Niederschlagsbildung: die
Niederschlagsbildung durch Eiskerne
(Wegener-Findeisen-Bergeron-Theorie) und die Niederschlagsbildung
durch Koaleszenz (Zusammenfließen von Teilchen).
Ragt eine Wolke, die aus vielen kleinen Wolkentröpfchen besteht, in
hohe Höhen, wo Temperaturen weit unter 0 Grad herrschen, bilden sich
aus den Nieseltröpfchen teilweise kleine Eiskerne. Zusätzlich können
jedoch auch kleine, feste und unlösliche Teilchen, die von einer
Wasserhaut umgeben sind, als Eiskern wirken. In der Wolke werden die
kleinen Wolkentröpfchen von den Eiskernen angezogen, sodass die
Eiskristalle auf Kosten von den Tropfen wachsen. Gleichzeitig haben
Eiskristalle, die meist größer sind als Wolkentropfen, eine größere
Fallgeschwindigkeit. Beim Herabfallen in der Wolke stoßen sie somit
mit kleineren Wolkentropfen zusammen, die sich dann mit den
Eiskristallen verklumpen (Koagulation). Fallen nun die Eiskristalle
in einen Bereich von positiven Temperaturen, schmelzen diese zu
Regentropfen.
Da auch in reinen Wasserwolken die Tröpfchengröße leicht
unterschiedlich ist und größere Wolkentropfen schneller fallen als
kleine, können Tropfen zusammenstoßen und schließlich durch
Zusammenfließen (Koaleszenz) anwachsen.
Je größer nun die Aufwinde in der Wolke sind, desto größer und
schwerer können die Tropfen oder Eiskristalle werden, bevor sie aus
der Wolke heraus fallen und sich den Weg zum Boden suchen. Jedoch
gibt es eine kritische Tropfengröße. Durch den Luftwiderstand
verformen sich große Tropfen so stark, dass sie schließlich
zerplatzen. In Schauerniederschlägen können die Tropfen maximal fünf
bis sechs, bei Gewittern in wenigen Fällen auch bis 8 Millimeter groß
werden. Normale Regentropfen verfügen meist über einen Durchmesser
von 0,2 bis 3 Millimeter.
© Deutscher Wetterdienst
Themenarchiv:
15.12. - Was tun an grauen Tagen?
14.12. - Von Meteoren, Hochnebel, Inversionen und optimaler Himmelssicht
13.12. - Novembergrau oder Dezembergrau?
12.12. - Extreme Dezember: 2010 und 2015 im Vergleich
11.12. - Hoch ELLINOR bringt graue Tristesse
10.12. - Ein erster Griff in die Spekulatiuskiste
09.12. - Die heiße Kugel
08.12. - Vom Winter keine Spur!
07.12. - Ein Sonntag mit Film und Fernsehen
06.12. - Jahresrückblick 2025 | Teil 2
05.12. - Jahresrückblick 2025 | Teil 1
04.12. - Tiefdruckeinfluss über dem östlichen Mittelmeer
03.12. - Deutschlandwetter im Herbst 2025
02.12. - Deutschlandwetter im November 2025
01.12. - Nebel im Winterhalbjahr
30.11. - Milder Winterstart
29.11. - Die atlantische Hurrikansaison 2025 - Ein Rückblick
28.11. - Glatteisgefahr im Südosten Deutschlands
27.11. - Wenn natürlich nicht mehr ausreicht: Die Kunstschneeproduktion
25.11. - In Gummistiefeln durch das Winterwetter
24.11. - Vor 20 Jahren: Das Münsterländer Schneechaos
23.11. - Erste Glatteislage der Saison
22.11. - Die Kugel der Mitte
21.11. - Lesen bildet
20.11. - Eisige Nächte am Wochenende
19.11. - Wenn es so kräftig regnet, dass es schneit: Die Niederschlagsabkühlung!
18.11. - Wintereinbruch – oder doch nur spätherbstliches „Geflöckel“?